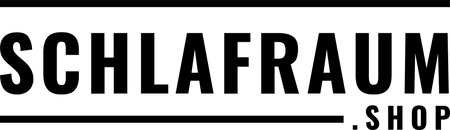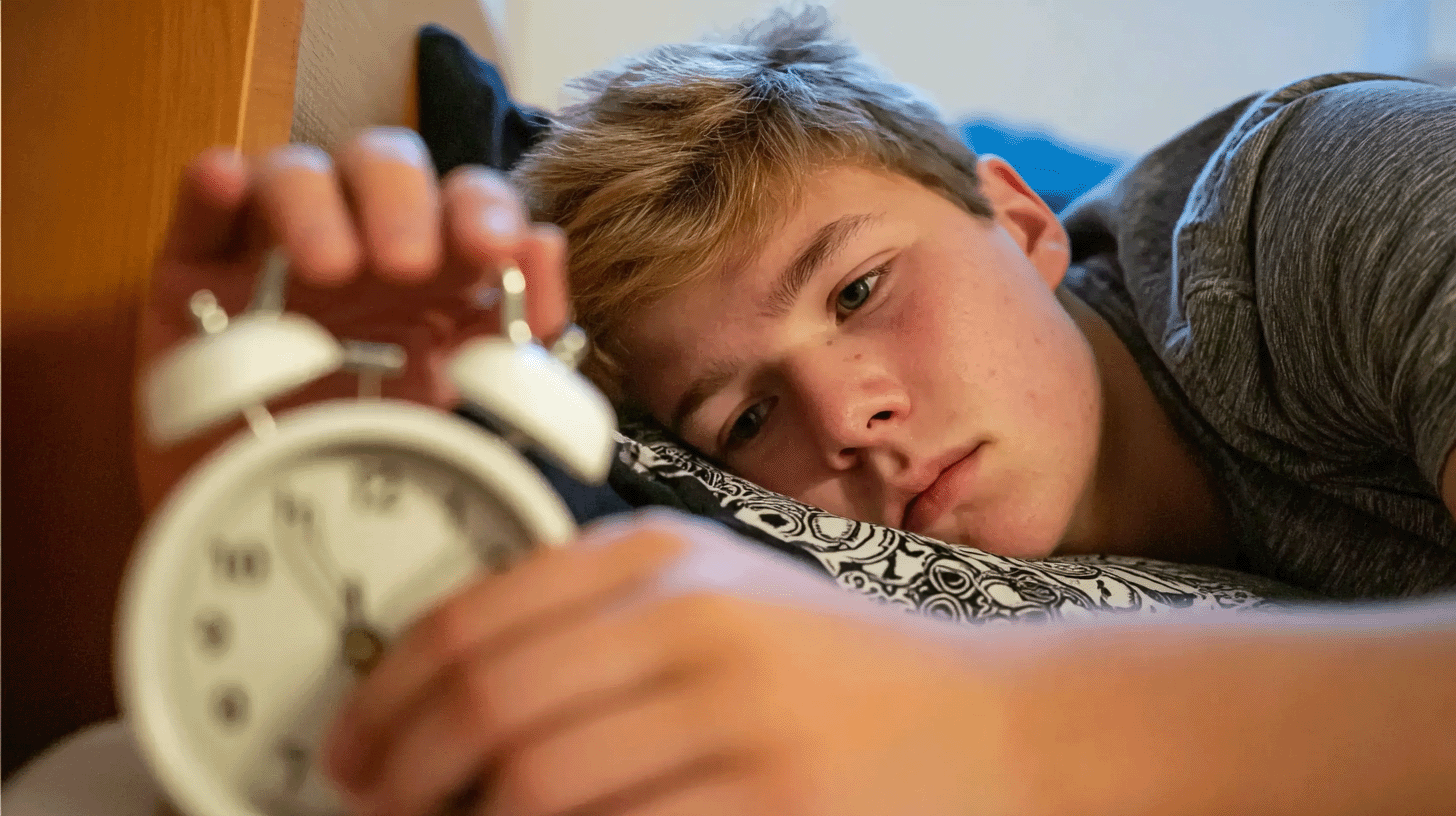Warum Schlafwandeln kein Mythos ist

Früher hielt man Schlafwandler für „mondsüchtig“. Heute weiß man: Der Mond ist nicht schuld – das Phänomen lässt sich medizinisch erklären. Beim Schlafwandeln ist das Gehirn nur teilweise aktiv: Einige Regionen schlafen noch, andere sind bereits wach.
Ein nächtliches Rätsel
Typisch ist, dass Betroffene mitten in der Nacht plötzlich aufstehen, durch die Wohnung laufen oder kleine Handlungen ausführen – etwa Kissen aufschütteln oder Möbel verrücken – und sich am nächsten Morgen an nichts erinnern. Manche Fälle sind spektakulärer: Menschen, die schlafend das Haus verlassen oder sogar ins Auto steigen.
Die Medizin bezeichnet Schlafwandeln als Parasomnie, also als ungewöhnliches Verhalten im Schlaf. Schlafforscherin Christine Blume von der Universität Basel spricht von einer „Aufwachstörung“ – nur Teile des Gehirns zeigen Aktivität, während andere in der Tiefschlafphase verharren.
Wer ist betroffen?
Bei Kindern tritt Schlafwandeln relativ häufig auf – bis zu 15 Prozent sind mindestens einmal davon betroffen. Bei Erwachsenen sind es deutlich weniger: Schätzungen gehen von zwei bis vier Prozent aus, Männer und Frauen gleichermaßen. Die Ursache ist nicht vollständig geklärt, eine genetische Komponente wird jedoch vermutet. Wenn ein Elternteil schlafwandelt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die Kinder betroffen sind.
Auslöser und Risikofaktoren
Das Phänomen zeigt sich meist im ersten Drittel der Nacht, wenn der Tiefschlaf besonders stark ist. Alles, was den Tiefschlaf verstärkt, kann Schlafwandeln begünstigen – etwa Fieber oder Schlafmangel. Auch Stress, Alkohol, Lärm oder bestimmte Medikamente (sogar Schlafmittel) können eine Rolle spielen. In warmen Sommernächten oder bei hellem Mondlicht kann das Risiko ebenfalls steigen.
Soll man Schlafwandler wecken?
Von einem abrupten Aufwecken raten Experten ab. Betroffene sind in diesem Zustand oft verwirrt und könnten sogar aggressiv reagieren, weil sie die Situation nicht verstehen. Besser ist es, sie ruhig wieder ins Bett zu begleiten.
Sicherheit im Alltag
Wer mit einem Schlafwandler zusammenlebt, sollte Vorsichtsmaßnahmen treffen: Türen abschließen, Fenster sichern und potenziell gefährliche Hindernisse im Schlafzimmer entfernen. So lassen sich Unfälle verhindern, wenn Betroffene unbewusst die Wohnung verlassen oder ein Fenster öffnen.
Behandlungsmöglichkeiten
Eine vollständige „Heilung“ gibt es nicht. Bei Kindern verschwindet das Schlafwandeln meist von selbst mit zunehmendem Alter. Medikamente werden nur selten eingesetzt, da Nebenwirkungen das Risiko oft nicht rechtfertigen. Wichtiger ist es, mögliche Auslöser zu reduzieren: ausreichend schlafen, Stress abbauen, Alkohol vermeiden und das Schlafzimmer bei Vollmond abdunkeln.
Fazit
Schlafwandeln ist kein Anzeichen für eine schwere Krankheit, sondern in den meisten Fällen ein harmloses Phänomen. Dennoch sollten Betroffene und ihre Familien achtsam sein, um Unfälle zu verhindern. Und auch wenn das Rätsel, warum genau nur ein Teil des Gehirns aufwacht, noch nicht endgültig gelöst ist, zeigt die Forschung: Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich gut damit leben.